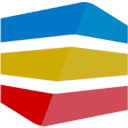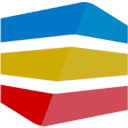DIE ERSTEN FÜNF SCHRITTE FÜR MEHR LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT (TEIL 1 EINER ZWEITEILIGEN SERIE)
Alle Fertigungsbetriebe stehen vor der gleichen Aufgabe: Die Umwandlung von Rohmaterial in fertige Erzeugnisse. Die Produkte müssen in der geforderten Qualität, in der geforderten Menge und in der gewünschten Zeit geliefert werden. Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltfragen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben, suchen Unternehmen ständig nach den wirtschaftlichsten und produktivsten Möglichkeiten, ihre Leistungen zu erbringen. Sind wir uns einig?Grundlegendes Prinzip - Alle Fertigungsbetriebe stehen vor der gleichen Aufgabe: Die Umwandlung von Rohmaterial in fertige Erzeugnisse. Die Produkte müssen in der geforderten Qualität, in der geforderten Menge und in der gewünschten Zeit geliefert werden. Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltfragen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Um wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben, suchen Unternehmen ständig nach den wirtschaftlichsten und produktivsten Möglichkeiten, ihre Leistungen zu erbringen. Sind wir uns einig?
 Auf dem Weg dorthin gibt es viele, zum Teil unvorhergesehene Einflüsse. Wissenschaftliche Daten wie Schnittbedingungen und Bearbeitungszahlen sind bekannt oder zumindest relativ leicht zu ermitteln. Um jedoch die Produktionsökonomie optimal zu nutzen, bemühen sich die Betriebe ständig, Probleme wie ungeplante Stillstände und Ausschuss zu minimieren oder zu beseitigen. Aber was wäre, wenn wir mehr Hinweise (Wissen) über die Dinge hätten, die schief gehen könnten? Hier kommt die Technologie und ein besserer Lösungsansatz ins Spiel.
Auf dem Weg dorthin gibt es viele, zum Teil unvorhergesehene Einflüsse. Wissenschaftliche Daten wie Schnittbedingungen und Bearbeitungszahlen sind bekannt oder zumindest relativ leicht zu ermitteln. Um jedoch die Produktionsökonomie optimal zu nutzen, bemühen sich die Betriebe ständig, Probleme wie ungeplante Stillstände und Ausschuss zu minimieren oder zu beseitigen. Aber was wäre, wenn wir mehr Hinweise (Wissen) über die Dinge hätten, die schief gehen könnten? Hier kommt die Technologie und ein besserer Lösungsansatz ins Spiel.
Das beste Beispiel für Prozessverbesserungen ist heute das industrielle Internet der Dinge (IIoT) oder Industrie 4.0 - Strategien und Taktiken, die modernste Technologien zur Datenerfassung, -speicherung und -weitergabe in den Fertigungsprozess integrieren. Dieses Technologieumfeld ist derzeit die höchste Ausprägung der Fertigungsentwicklung und erfordert ein starkes Engagement des Managements, Fachpersonal und erhebliche Investitionen.
Doch verfügen viele Unternehmen leider nicht über die umfangreichen Ressourcen globaler Industriegiganten wie General Electric oder General Motors und haben das Gefühl, dass Produktivitätssteigerungen unerreichbar sind. Das ist nicht der Fall. Einfache, kosteneffiziente Analysen und Maßnahmen sind in greifbarer Nähe und können sich sehr positiv auf die Produktivität von kleinen bis mittleren Betrieben auswirken. Bevor man in neue Computer, Roboter oder Personal investiert, sollte jeder Betrieb, ob groß oder klein, eine grundlegende Prozessanalyse durchführen und die aktuellen Betriebsmittel und Abläufe optimieren. Interessiert?
DREI PHASEN UND DIE ERSTEN FÜNF SCHRITTE
Die Organisation der betrieblichen Praxis beginnt mit der Betrachtung des Produktionsprozesses in drei Phasen. Die erste Phase ist die Auswahlphase, in der es um die Wahl der Bearbeitungsstrategie, der Werkzeuge und der Zerspanungsbedingungen geht. Die nächste Phase ist die Sammelphase, in der die ausgewählten Werkzeuge und Strategien in einem Bearbeitungsprozess zusammengeführt werden. Die Realisierung ist die dritte Phase und setzt den Prozess in die Tat um.
In vielen Fällen bleiben die Ergebnisse der dritten Phase hinter den Erwartungen zurück, und es sind einige Schritte erforderlich, bis die Realität sich mit der Erwartung deckt. Die Schritte können technischer Natur sein, wie z. B. die Suche nach Möglichkeiten zur Abmilderung der Schnittkräfte, oder wirtschaftlicher Natur, einschließlich Maßnahmen zur Kostensenkung. Lassen Sie uns mit den ersten fünf beginnen.
1. INTELLIGENTE BUDGETKONTROLLE
Ein gängiger Ansatz bei der Budgetierung der Metallverarbeitung besteht darin, jedes Element des Prozesses zu einem möglichst niedrigen Preis zu beziehen. Es ist jedoch ratsam, die Auswahl der Werkzeuge nicht allein auf den Preis zu stützen. Bevor man über den Preis spricht, sollte man sich Gedanken über das gewünschte Endergebnis machen. Wenn ein Werkstück mit engen Toleranzen und höchster Qualität angestrebt wird, sind für die Bearbeitung teurere Präzisionswerkzeuge erforderlich.
Die Kosten, die entstehen, wenn man sich mit kostengünstigen Werkzeugen müht, um eine hohe Bauteilqualität zu erreichen, und dabei nicht nutzbare Produkte herstellt, übersteigen die Kosten für teurere Werkzeuge. Andererseits wird bei weniger strengen Qualitätsanforderungen ein Teil der Möglichkeiten von hoch präzisen Werkzeugen verschenkt. Das Erkennen des Gesamtzieles des Prozesses ist der erste Schritt zu kosteneffizienten Kaufentscheidungen.
2. INTELLIGENTER UMGANG MIT EINSCHRÄNKUNGEN
Im Gegensatz zu theoretischen Erörterungen der Metallbearbeitungstheorie sind reale Metallbearbeitungsvorgänge an praktische Beschränkungen gebunden, zu denen Maschinenleistung und -stabilität sowie Kundenanforderungen hinsichtlich Abmessungen und Oberflächengüte gehören. Die Zerspanungsbedingungen können in einem sehr großen Bereich variiert werden, aber die Auswirkungen verschiedener Parameterkombinationen auf die Schnittkräfte und die Oberflächengüte schränken möglicherweise einige Auswahlmöglichkeiten ein.
Dennoch ist eine einfache Reduzierung der Schnittparameter insgesamt kein sinnvoller Weg, um mit Prozessbeschränkungen umzugehen. So wirken sich beispielsweise Änderungen der Schnitttiefe stärker auf den Verbrauch der Maschinenleistung aus als Änderungen des Vorschubs. Die Kombination aus geringerer Schnitttiefe und höherem Vorschub kann die Produktivität bei begrenzter Maschinenleistung verbessern.
3. OPTIMIERUNG DER WERKZEUGANWENDUNG
Aufgrund der enormen Anzahl an Werkzeuggeometrien, -größen und -materialien sind die möglichen Konfigurationen von Zerspanungswerkzeugen praktisch unbegrenzt. In der Regel treffen Unternehmen die Auswahl der Werkzeuganwendung nacheinander. Sie wählen ein bestimmtes Werkzeug, um ein bestimmtes Merkmal an einem Teil zu fertigen, und dann ein anderes Werkzeug, um ein anderes Merkmal zu bearbeiten.
In einem Beispielfall würden zwei separate Werkzeuge verwendet werden, um eine Welle zu drehen und eine breite Nut mit zwei quadratischen Schultern herzustellen. Konkret dreht ein Werkzeug die Welle auf den gewünschten Durchmesser und schneidet eine Schulter und die Breite der Nut, gefolgt von einem zweiten Werkzeug, das die andere Schulter schneidet. Jedes Werkzeug wird separat programmiert und optimiert, was separate Programmier- und Verwaltungskosten verursacht.
Eine andere Strategie bei der Werkzeugauswahl besteht darin, ein hochspezialisiertes, kundenspezifisches Werkzeug zu entwickeln, das mehrere Merkmale in einem Bearbeitungsdurchgang erzeugen kann. Die Strategie ist zwar praktisch, aber die Entwicklung und Herstellung von Spezialwerkzeugen ist teuer.
Zwischen den beiden Extremen liegt ein Ansatz, bei dem ein Standardwerkzeug verwendet wird, das für mehr als eine Anwendung ausgelegt ist (sog. multidirektionale Werkzeuge). Ein ideales Beispiel für diesen Ansatz ist das MDT-Werkzeug von Seco.
Die Funktionen des Werkzeugs ermöglichen es, den Durchmesser zu drehen, die erste Schulter zu erstellen, die Nut zu schneiden, und am Ende auch die zweite Schulter zu schneiden. Selbst wenn ein solches multidirektionales Werkzeug nicht mit den optimierten Schnittparametern der beiden separaten Werkzeuge arbeitet, machen die Einsparungen bei der Werkzeugbestückung, der Programmierung, der Werkzeugwechselzeit und den Lagerkosten das multidirektionale Werkzeug zur bevorzugten Wahl.
4. KOMPLEXER WERKSTÜCKANSATZ (GRUPPENTECHNOLOGIE)
Ähnlich wie bei der Anwendung von Werkzeugen, die zwei oder mehr Arbeitsgänge kombinieren, kann ein Betrieb Werkzeuge verwenden, die in der Lage sind, ähnliche Merkmale für eine Reihe von Werkstücken zu erzeugen. Eine Betrieb kann eine große Bandbreite unterschiedlicher Werkstücke bearbeiten, die jedoch gemeinsame Merkmale wie Bohrungen, Nuten und gefräste Oberflächen aufweisen.
Um die Bearbeitung komplexer Teile zu beschleunigen, kann ein Betrieb ähnliche Merkmale als Gruppe betrachten und ein Werkzeug auswählen, das für einen bestimmten Arbeitsgang optimiert ist, wie z. B. eine Bohrungsbearbeitung, die an verschiedenen Teilen wiederholt wird. Das optimierte Werkzeug maximiert zum einen die Produktivität und senkt zum anderen die Kosten, wenn man die Arbeitszeit berücksichtigt, die für die wiederholte Programmierung der Werkzeuge für jedes einzelne Teil benötigt wird. Der Gruppentechnologie Ansatz trägt auch dazu bei, den Werkzeugbestand zu reduzieren.
5. MINIMALE FUNKTIONALE WERKSTÜCKQUALITÄT
Auch wenn das Konzept zunächst befremdlich erscheinen mag, müssen die Betriebe erkennen, dass es notwendig ist, nur die niedrigstmögliche Werkstückqualität zu erreichen, die den Kundenspezifikationen und funktionalen Anforderungen entspricht. Es besteht keine Notwendigkeit, diese Anforderungen zu übertreffen. Bei einer Werkstücktoleranz von 5 Mikrometern ist das Erreichen von 3 Mikrometern eine Verschwendung von Zeit und Geld. Um die engeren Toleranzen zu erreichen, sind hochwertigere Werkzeuge und präzisere Bearbeitungsprozesse erforderlich. Die Kunden werden sich jedoch weigern, den Preis für eine solche ungefragte höhere Qualität zu zahlen, und der Auftrag wird für das Unternehmen zu einem Verlustgeschäft.
Einige Qualitätsmängel, wie z. B. Grate, müssen natürlich behoben werden. Außerdem gibt es Situationen, in denen geringfügige Kostenunterschiede irrelevant sind - Werkzeugkostenunterschiede von ein paar Euro oder Cent sind bedeutungslos, wenn man sie mit dem Wert eines großen Titanbauteils für die Luft- und Raumfahrt vergleicht, welches das Werkzeug bearbeiten soll. Um die Kosteneffizienz zu maximieren, sollte ein Betrieb die Produktionsqualität an die funktionalen und qualitativen Anforderungen des Werkstücks anpassen.
Im zweiten Teil werden die nächsten fünf Schritte für mehr Leistung vorgestellt. Den Artikel dazu finden Sie hier.
Inline Content - Survey
Current code - 5fce8e61489f3034e74adc64